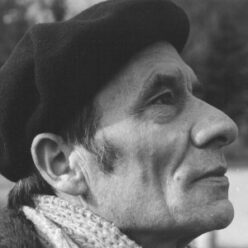Walter Prolingheuer
Rhythmische Gliederung, fugaler Aufbau in Form und Farbe sind mir wichtig, die Verzahnung und Aufeinanderbezogenheit der einzelnen Bildelemente analog einer Bachschen Fuge.
Ein durchwaltender Rhythmus steht als Kompositionsprinzip am Beginn der Entwurfsarbeit, zunächst unabhängig von der Thematik, obwohl der Inhalt als anregender Motor immer schon mitschwingt. Das „Gegenständliche“ ist nicht Selbstzweck, es muß sich diesem übergreifenden Rhythmus einordnen, ohne jedoch seinen Eigenwert zu verlieren.
Farbe und Form korrespondieren zu einem dichten Gewebe gegenseitiger Abhängigkeiten im umgrenzten Bildraum. Es ist nötig, diesen Bildraum nach außen zu umschließen, um ihn nicht in den andrängenden ungeordneten Farben und Formen der Umwelt, im Nichtgemeinten, zerfließen, untergehen zu lassen. (Auch eine Bachsche Fuge ist gegen die Geräusche der Umwelt durch den Raum, in dem sie ertönt, umschlossen, abgehoben.)
Dies ist eine Möglichkeit der Gestaltung neben vielen anderen. Es gibt keine allgemeingültige „Grammatik“ der Kunst, es sei denn, man würde die Individualität des Kunstschaffenden und des Kunstbetrachters unzulässig verkürzen und viele Wege und Zugänge zur Kunst vermauern.
Erfahrungen können nur scheinbar, nur an der Oberfläche allgemein sein, in Wahrheit sind sie höchst individuell. Also kann der Künstler nicht erwarten, daß seine Bilder und Objekte Erfahrungen allgemeiner Art widerspiegeln und allen Betrachtern gleichermaßen zugänglich sind. Der Zugang zu den Bildern ist in jedem Fall ein individueller.
Findet der Betrachter trotz eingehenden Bemühens keinen Zugang zum Bildwerk, hat der Künstler nicht das Recht, das Publikum deswegen zu beschimpfen. Er hat zu akzeptieren, daß seine Werke möglicherweise für eine Anzahl Betrachter ohne Belang und ohne Bedeutung bleiben.
Es mag sein, daß ein Künstler, überwältigt und geängstigt von der realen Fülle des Lebens, sich zurückzieht auf ein reduziertes Ambiente aus Kreis, Quadrat und Winkel, um so die Grundformen der Wirklichkeit, die Einfachheit des Lebens, wiederherzustellen. Wie alle Kunst, ist auch dies eine legitime Fiktion, die solange einen Sinn trägt, als sie nicht zur Doktrin erstarrt. Komplementär dazu könnte ein anderer, der sich in einem rechteckigen, winkligen, kreisförmigen Gehäuse eingesperrt fühlt, diesen Käfig aufbrechen und mit seiner Phantasie eine fiktive Lebenswelt als Bildwelt in sich erwecken. Beides sind Fiktionen ein und derselben Wirklichkeit oder Markierungen, um einen Weg durch die Welt zu finden.
Ein „ungegenständlich“ genanntes Bildwerk ist nicht darum gut oder schlecht, weil es keine Gegenstände zeigt. Ebensowenig ist ein künstlerisch gestaltetes Werk gut oder schlecht, weil es dem Auge die Vorstellung von Gegenständlichkeit suggeriert. Auch das noch so „natürlich“ oder „realistisch“ anmutende Abbild ist nicht die gegenständliche Wirklichkeit selbst. Es ist ein aus Linien, Punkten, Flächen und Volumen gefügtes Gebilde, ein Zeichen, das für etwas steht, auf etwas hinweist, was es selbts nicht ist.
Die Qualität eines Kunstwerkes beruht auf Kriterien, die am besten unter dem Begriff „Stimmigkeit“ erfaßt sind. Auch die stärksten Form-, Farb- und Materialkontraste werden in einem gelungenen Werk von dieser Stimmigkeit in überzeugender Weise zusammengehalten.
Mich reizt die Auseinandersetzung mit Mythen und Sagen der Vergangenheit. Sie können m. E. selbst für unsere moderne Zeit, wenn auch von einer anderen Erfahrungsstufe aus, wichtige Einsichten vermitteln.
So darf der Prometheus-Mythos des griechischen Sagenkreises durchaus als Warnung gesehen werden: Noch so gut gemeinter „Feuerraub“ kann, wenn übermütige oder fahrlässige Hände damit hantieren, unvorstellbare Katastrophen auslösen. Wer denkt dabei nicht an das furchtbar strahlende Feuer „heller als tausend Sonnen“, dessen Entfachung Mensch und Umwelt bedrohen?
Allegorische Bezüge sind für mich z. B. das Lamm, seit Urzeiten als Opfertier und Gabe an göttliche Mächte benutzt; der Phönix, Symbol für Neubeginn aus Tod und Vernichtung, oder das Kind, als unwissend begonnenes Leben am Rand des Abgrunds. Was für ein aktueller Hintersinn in der Paradiesgeschichte, wenn die dem Baum der Erkenntnis entrissene Frucht den Zugang zum „Baum des Lebens“ versperren kann! Oder wenn die männliche Rippe nach diesem Mythos das Weib in sich enthält, und damit eine latent vorhandene Männlichkeit des Weibes und eine versteckte Weiblichkeit des Mannes angedeutet wird – Material für eine Emanzipationsdebatte!
Bildtitel geben zwar einen Anstoß zum Eintritt in die Bilder, sind aber sonst belanglos, da der Betrachter mit seinen eigenen Erfahrungen in der Lage ist, die Bildinhalte für sich zu bestimmen und zu verarbeiten. Interpretationen können Hilfen sein, verführen aber leicht zur bloßen Übernahme vorgedachter Gedanken. Sinnvoller ist es, wenn der Betrachter seinen eigenen Zugang zum Werk sucht und sich nicht vorweg ins Korsett einer scheinbar allwissenden Interpretation zwängen läßt.
Enkaustik (Wachsmalerei) ist eine alte Technik, schon von Ägyptern und Griechen bei Bildnissen auf Holztafeln benutzt. Die Farbe wird für den Auftrag erwärmt (oft genügt schon Handwärme) und in dünnen Schichten aufgetragen. Wachsfarben bräunen im Gegensatz zu Ölfarben kaum, sie behalten ihre Frische und Leuchtkraft. Den Farben haftet etwas Immaterielles, Durchsichtiges an. Sie bestätigen das Goethewort von den Farben als „Taten und Leiden des Lichts“, ihre Entstehung aus der Verbindung des Lichts mit der Materie.
Wachsfarbe auf der Basis von Bienenwachs muß abschließend gehärtet werden, entweder durch Einbrennen oder durch ein alkohol- und schellackfreies Fixat. Als Malgründe geeignet sind Holz und Papier, aber auch Leinwand und Hartfaser.